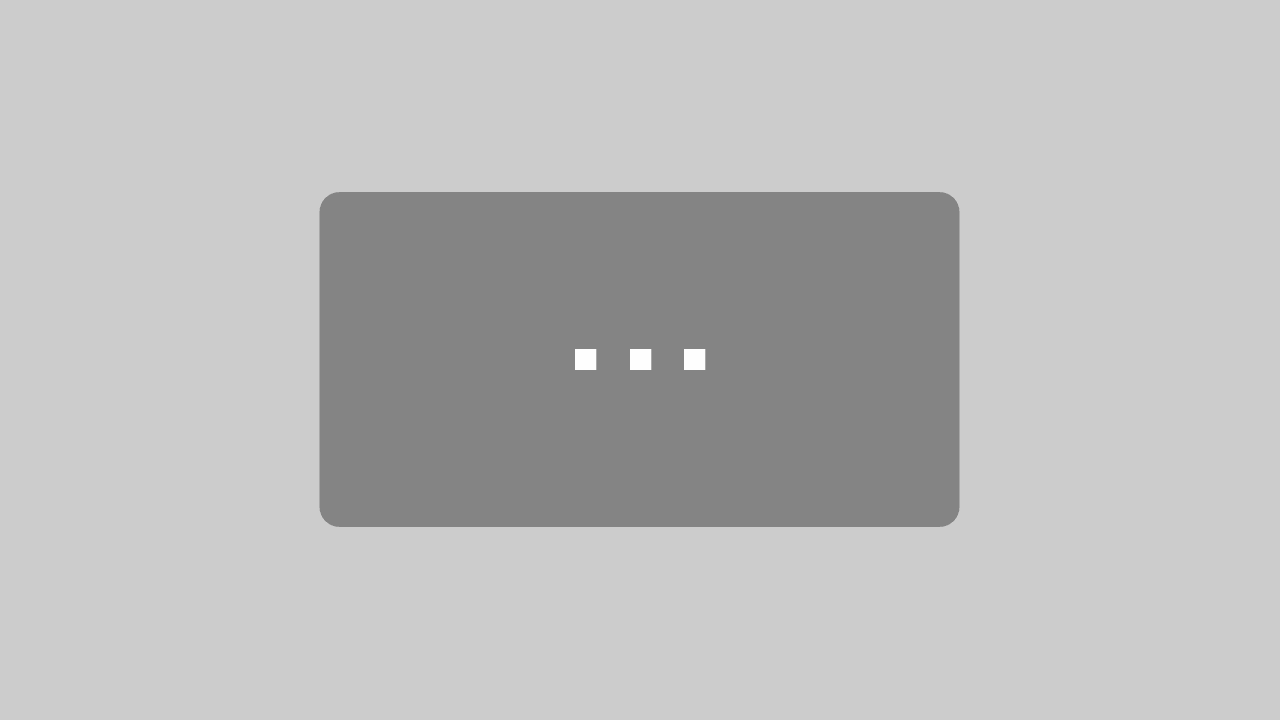Füllhorn der Chancen – oder ein Feld ungelöster Probleme?
Timing, Antifragilität und Zukunftsfähigkeit in der Ära von Deep Tech.
Veranstaltungsdatum: 23.09.2023
Stephan Huthmacher
Der große französische Romancier des 19. Jahrhunderts, Victor Hugo, hat einmal gesagt: „Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Gegenwärtig, wo sich die generative KI und die dynamischen, an die menschliche Biologie angelehnten Entwicklungen in der Robotik auf breiter Front Bahn brechen, scheint dieses Bonmot treffender denn je. Diese disruptiven Technologien sind nicht nur mächtig, in einigen Bereichen wirken sie wie eine Abrissbirne. Jedenfalls sind sie in rasantem Tempo dabei, unsere Arbeitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft radikal umzugestalten.
KI steht im Zentrum dieser Transformation. Was noch vor Kurzem als oft dystopische Science-Fiction oder Vision einiger mutiger Vordenker:innen galt, ist heute Realität. Die revolutionäre Kraft dieser Deep Tech-Innovation ist inzwischen unübersehbar: in Schulen, Universitäten, bis hin zu Entwicklungs- und Forschungslaboren, Marketingabteilungen und Vorstandsetagen der Wirtschaft. Die generative KI hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie wir arbeiten, lernen, forschen und uns weiterbilden. Zweischneidig wie sie ist, kann sie uns einerseits informierter, schneller, effizienter und kreativer machen. Andererseits hat sie in Verbindung mit autonomen Systemen und humanoider Robotik die Macht, unsere Vorstellung, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen, in einem Maße und Tempo zu beeinflussen, das von vielen als überwältigend empfunden wird.
Die Veröffentlichung von ChatGPT hat eingeschlagen wie ein Asteroid. Jetzt, wo sich der Staub etwas gelegt hat, können wir sowohl die Potenziale als auch die Herausforderungen der generativen KI klarer sehen. Dennoch oder gerade deshalb reichen die Reaktionen von ungefilterter Begeisterung über Mahnrufe und ernsthafte Bedenken bis hin zu Forderungen nach Regulierungen oder sogar nach einem Moratorium. Während also die einen diese Technologie als Erweiterung ihrer Fähigkeiten sehen und schätzen, sehen sich andere von ihr in Frage gestellt und zur Neupositionierung gezwungen.
Für Unternehmen wird es entscheidend sein, den richtigen Zeitpunkt und das richtige Maß zu finden, um in diese Technologie zu investieren und sie für die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Sie stehen vor wichtigen Fragen: Ist unser Geschäftsmodell vor dem Hintergrund generativer KI und anderer Deep Tech-Innovationen noch zukunftsfähig? Wie hoch sind die Gesamtkosten durch Einbußen an Effizienz und Innovation, wenn wir mit der Digitalisierung zu lange zögern? Und: Wie sieht es mit unserer Veränderungsfähigkeit aus? Selbst wenn wir das richtige Timing finden – welche organisatorischen, mentalen und kulturellen Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, um sich in dem Tempo verändern zu können, dass die rasante Technologie-Entwicklung vorlegt?
Diese Fragen und Herausforderungen betreffen nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten. Wer hat die Nase vorn im Rennen um die Pole Position in Sachen Deep Tech? Welche Faktoren machten ein Land wie China so erfolgreich? Gelten sie immer noch? Und wie positionieren wir uns in diesem Spannungsfeld von Partnerschaft und Rivalität?
Hinzu kommt: KI und Neurorobotik berühren uns im Kern dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein. Die Reaktionen polarisieren auch hier. Gefragt, was das spezifisch Menschliche an uns ist, haben wir uns bisher auf unsere Fähigkeit zur Innovation, Schöpfung, Intelligenz und Kreativität berufen. Die Kritiker:innen der aktuellen Entwicklung sagen: All dies werde durch die generative KI mit einem großen Fragezeichen versehen. Andere sagen: Die KI wird zwar einiges überflüssig machen, doch noch mehr radikal verändern oder weiterentwickeln und neue, heute noch unbekannte Türen öffnen. Es wird andere Formen von Kreativität geben. Die Innovationsfähigkeit und der Einfallsreichtum von Menschen und Organisationen wird sich an anderen Maßstäben messen lassen müssen. Auch das Tempo wird sich insgesamt verändern. Voraussetzung dafür wird sein, dass wir nicht gegen, sondern mit der Technologie und ihren Möglichkeiten gehen und sie in einer Mensch-Maschine-Kooperation für unsere Zwecke nutzen. Time will tell.
Eines steht fest: Noch nie war Deep Tech so aufregend wie heute! Dieser Dynamik versuchen wir auf unserem Kongress gerecht zu werden, indem wir einen weiten thematischen Bogen spannen. Unsere Referentinnen und Referenten werden uns die Inspiration für etwas geben, das wir Menschen (nach wie vor!) am besten können und das wir für unsere Weiterentwicklung als Individuen und als Gesellschaft so dringend brauchen: bereichernde Begegnungen, anregende Gespräche und erkenntnisfördernde Diskussionen.
Artikel: Rückschau auf die 15. Petersberger Gespräche
Der Salon für Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft – zum 15. Mal
Der Kongress beginnt für mich bereits mit dem Passieren der Schranke und der Kontrolle durch die Bundespolizei. Nur geladene Gäste erhalten Zutritt. Nachdem das schwere Eisentor den Weg frei macht, liegt die mich jedes Mal aufs Neue beeindruckende Parkanlage vor mir. In ihrem Zentrum der klassizistische Springbrunnen und dahinter die Villa Hammerschmidt in den ersten Sonnenstrahlen des noch jungen Tages. Beim Gang durch die große Holzpforte begrüßt mich dieser besondere, mir inzwischen vertraute Geruch von Historie und Bedeutung. Ich freue mich, hier zu sein und erwarte viel von dem bevorstehenden Tag...
Lesen Sie hier den gesamten Artikel von Gründer und Gastgeber der Petersberger Gespräche Stephan Huthmacher.
Video: Impressionen der Petersberger Gespräche 2023
Die 15. Petersberger Gespräche im Schnelldurchlauf: Beschäftigte sich der Kongress im vorherigen Jahr mit der Bedeutung des Perspektivwechsels für ein neues Denken und neues Tun in Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, so wandten sie sich am 23. September 2023 erneut einem technologisch geprägten Thema zu. Es lautete: „Füllhorn der Chancen oder ein Feld ungelöster Probleme? Timing und Antifragilität in der Ära von Deep Tech.“ Es gehört zum Konzept unseres seit 2005 stattfindenden Kongresses, dass das Thema einen Rahmen für die Keynote und die folgenden Vorträge darstellt. Auch in diesem Jahr standen die Vorträge unter dem Anspruch, sowohl Informationen als auch Anregungen für die darauffolgenden Podiums- und Gruppendiskussionen sowie Gespräche zu liefern. Schwerpunktthemen waren - Generative Künstliche Intelligenz um ChatGPT und Co. mit den Vorträgen von Prof. Dr. Hans Uszkoreit & Dr. Andrej Fischer; - Quanten Computing mit dem Vortrag von Dr. rer. nat. Dr. h. c. Heike Riel; - Bedeutung und Potenziale von Chinas technologischem Vorsprung in der Gesprächsrunde mit dem China-Experten Frank Sieren; - Eine philosophische Perspektive auf den immer größer werdenden Einfluss von Technologie auf das menschliche Dasein mit dem Beitrag von Thea Dorn.
Video: Füllhorn der Chancen – oder ein Feld ungelöster Probleme? Eröffnungsrede von Stephan Huthmacher
"Füllhorn der Chancen - oder ein Feld ungelöster Probleme? Timing, Antifragilität & Zukunftsfähigkeit in der Ära von Deep Tech." - so lautet das Motto der 15. Petersberger Gespräche. In seiner Eröffnungsrede geht Gastgeber und Initiator Stephan Huthmacher, CEO der Comma Soft AG, auf seine Leitfrage und -gedanken näher ein.
Video: Über die Wurzelwerke von Innovation – Einführungsrede von Prof. Dr. Dr.-Ing. h. c. Heinz-Otto Peitgen
Moderator Prof. Dr. Dr.-Ing. h. c. Heinz-Otto Peitgen führt in das Thema und die Vorträge der 15. Petersberger Gespräche ein.
Die Petersberger Gespräche® haben inzwischen Tradition und stehen für ein innovatives, grenzüberschreitendes Veranstaltungsformat. Dazu tragen nicht nur die Referent:innen und die engagierten Teilnehmer:innen bei, sondern auch die besondere Art der Moderation, wie sie Professor Heinz-Otto Peitgen führt.
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Prof. Peitgen auch in diesem Jahr bereit erklärt hat, die Hauptmoderation zu übernehmen und unsere Veranstaltung in seiner authentischen, facettenreichen und souveränen Art zu leiten. Prof. Dr. Dr.-Ing. h. c. Heinz-Otto Peitgen ist Mathematiker. Er hat von 1977 bis 2012 an Universitäten in den USA (University of California, Florida Atlantic University) und Deutschland (Universität Bremen) gelehrt. Seine Bücher über Chaostheorie und Fraktale Geometrie sind weltweite Bestseller. In den letzten Jahrzehnten seiner wissenschaftlichen Karriere widmete er sich der angewandten medizinischen Forschung. Besondere Schwerpunkte waren Früherkennung und umfassende Diagnose von Brustkrebs sowie die Verbesserung der onkologischen Leberchirurgie. Im Jahr 1995 gründete er hierfür ein unabhängiges Forschungszentrum, das 2008 als Fraunhofer MEVIS in die Fraunhofer Gesellschaft aufgenommen wurde. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Im Jahr 1997 gründete er ein Software-Unternehmen, das er 2007 unter dem Namen MeVis Medical Solutions AG an die Frankfurter Börse brachte. Im Jahr 2006 wurde er mit dem Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Visionär ausgezeichnet.
Seine besondere Liebe gilt der Musik. György Ligeti widmete ihm seine 17. Klavieretüde.
Video: Generative AI: Stärken, Chancen und Risiken
Durch ChatGPT konnten sich bereits Millionen von Nutzer:innen von den Fähigkeiten der generativen KI überzeugen. Die neue KI mit ihren eloquenten und superschlauen Basismodellen wird nicht nur die Wirtschaft, sondern auch alle anderen Bereiche der Gesellschaft tiefgreifend verändern.
In seinem Vortrag wird Prof. Hans Uszkoreit schildern, was diese Modelle von der bisherigen KI unterscheidet. Ferner wird er darauf eingehen, warum und auf welche Weise die KI-Modelle die menschliche Intelligenz einerseits ganz deutlich übertreffen und andererseits in bestimmten Aspekten auch nicht annähernd erreichen. Er wird erläutern, wie sich Wissen und Können der KI-Modelle auch von der menschlichen Kognition unterscheiden. An Beispielen wird er dann zeigen, wie die gescheite Kombination von menschlicher und maschineller Intelligenz Leistungen erbringen kann, zu denen weder Mensch noch Maschine allein imstande sind.
Diese mächtige Technologie konfrontiert uns auch mit interessanten Herausforderungen. Die Arbeitswelt, unsere Bildung und unser Rechtssystem müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Andererseits müssen aber auch Wissen und Fähigkeiten der Modelle an die Bedürfnisse und die kulturellen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen der Einsatzgebiete angepasst werden.
Derzeit ist die Technologie geographisch sehr ungleich verteilt. Welche Risiken ergeben sich daraus für unsere Sicherheit und technologische Souveränität? Durch die gigantischen Rechenaufwände für das Trainieren der Gigamodelle konzentrieren sich die besten Systeme und auch die technologische Kompetenz auf wenige Orte bzw. in wenigen großen internationalen Unternehmen. ie meisten und die leistungsfähigsten Foundation-Modelle befinden sich in den USA und in China. Wie könnte Europa sicherstellen, dass auch unsere Wirtschaft und Gesellschaft ohne zu große Abhängigkeiten von der KI profitieren werden?
Video: Grenzenloser Einsatz von KI? – Prof. Dr. Hans Uszkoreit im Interview
Im Interview mit dem Journalisten Ralph Hötte beantwortet Prof. Hans Uszkoreit, Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), Fragen im Anschluss an seinen Vortrag, den er unter dem Titel "Generative AI: Stärken, Chancen & Risiken" auf den Petersberger Gesprächen hielt. Es geht unter anderem um Aspekte, die wir noch nicht über generative KI wissen und aufgrund derer wir noch nicht um die Grenzen ihrer Fähigkeit wissen.
Video: Quantum Computing – The Path to Quantum Advantage
Quantencomputing – eine völlig neue Art der Berechnung, die sich nach den Gesetzen der Quantenphysik verhält, – entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit. Trotz der kontinuierlichen Fortschritte der CMOS-Mikroprozessoren, einschließlich spezieller Beschleuniger für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz, gibt es immer noch viele wichtige und relevante mathematische Probleme, die für klassische Computer unlösbar sind. Quantencomputer eröffnen eine neue Methodik des Rechnens basierend auf Quantenbits und ermöglichen somit die Lösung schwieriger und komplexer Probleme, die für Wirtschaft und Wissenschaft relevant sind.
In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Grundlagen und der Funktion von Quantencomputern gemacht und Durchbrüche bei der Weiterentwicklung der Hardware- und Softwaretechnologie, bei der Verbesserung der Algorithmen und bei der Entwicklung von relevanten Anwendungen erzielt. Wir entwickeln dieses völlig neue Rechensystem, den Quantencomputer, von Grund auf.
Der Stand der Technik entwickelt sich extrem schnell weiter und die Leistung gemessen in Anzahl Qubits, Qualität und Geschwindigkeit steigt rasant an, sodass, wie kürzlich gezeigt wurde, Quantencomputersysteme anfangen, mit Hochleistungsrechnern bei relevanten Problemen in Konkurrenz zu treten. Spannende Zeiten!
Video: Der „Quantenvorteil“ & generative KI – Dr. Heike Riel im Interview
Angeschlossen an ihren Vortrag "Quantum Computing: The Path to Quantum Advantage" im Rahmen der Petersberger Gespräche 2023 beantwortet Referentin und IBM Fellow Dr. rer. nat. Dr. h. c. Heike Riel die Fragen von Journalist Ralph Hötte. Es geht u.a. um Möglichkeitsdenken im Bereich der generativen KI in Verbindung mit Quantencomputing und in diesem Kontext um den Potenzialgehalt für die Wirtschaft.
Video: ChatGPT jenseits ChatGPT
Schon 1950 führte Alan Turings „Imitation Game“ natürliche Sprache als universelle Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ein. Mit dem Beherrschen von menschlicher, natürlicher Sprache ist nun ein Meilenstein der Künstlichen Intelligenz erreicht, dessen ganze Tragweite wir heute nur langsam erahnen. Dabei ist der eigentliche Durchbruch nicht das Absolvieren des „Turing Tests“, dessen Eignung zur Identifikation einer künstlichen Person ohnehin zweifelhaft ist. Vielmehr bedeuten ChatGPT & Co. das Durchbrechen von Mauern zwischen uns Menschen mit unserer Fähigkeit zur Innovation und Kreation und digitalen Expertensystemen. Die Verknüpfung von Sprachmodellen mit Plugins, also bidirektionalen Übersetzungsmodulen für Systeme wie Wolfram Alpha oder Programmiersprachen wie Python, ermöglicht den einfachen Zugang zu mächtigen Werkzeugen, die bisher nur einer kleinen Elite von Spezialist:innen vorbehalten waren. Die Arbeitsweise und das Selbstverständnis von Wissenschaftler:innen, Softwareentwickler:innen
und Data Scientists wird sich dadurch neu definieren (müssen).Auch für die Unternehmensführung bricht eine neue Ära an. Wie schon jetzt absehbar, werden mit entsprechenden Plugins für die Daten- und Wissenslandschaften von Unternehmen ganz neuartige Assistenzsysteme für operative und strategische Entscheidungsprozesse möglich. Assistenzsysteme, die Branchenexpertise und strategische Methodik mit den eigenen Unternehmensdaten kombinieren. Aber selbst das ist nur der Anfang. Denn natürliche Sprache als universelle Schnittstelle kann ermöglichen, dass Systeme untereinander kommunizieren und Transaktionen ausführen können. Sie werden somit zu kompetenten Agenten.
Im Gegensatz zu früheren Innovationen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz haben Sprachmodelle einerseits das größte Transformationspotenzial für die meisten Branchen und meisten Unternehmen. Andererseits war nie eine neue Technologie zugänglicher und hat die Fantasie von Menschen derart angeregt. Mit vielen konkreten Beispielen zeigt Dr. Andrej Fischer, was an diesem Wendepunkt heute bereits möglich und absehbar ist.
Video: Wohin führt uns Generative KI? – Dr. Andrej Fischer im Interview
Dr. Andrej Fischer beantwortet im Anschluss an seinen Vortrag Fragen von Journalist Ralph Hötte im Interview. Es geht um Fragen nach dem Timing, Voraussetzungen und Datenschutz zum Einstieg in die Nutzung generativer KI im Unternehmenskontext und um die Frage, inwiefern KI uns besser und effizienter macht.
Video: ChatGPT, Large Language Models & Quanten Computing – Podiumsgespräch
Im Anschluss an ihre Vorträge beantworten Prof. Dr. Hans Uszkoreit, Dr. rer. nat. Dr. h. c. Heike Riel und Dr. Andrej Fischer Fragen aus dem Publikum.
Video: Vom Kopierladen über die Werkbank der Welt bis zur technologischen Innovationsführerschaft: Was steckt hinter Chinas rasanter Entwicklung?
Verstehen wir Chinas Dynamik richtig? Verstehen die Chinesen uns?
Ökonomischer Partner, systemischer Rivale, Systemfeind und noch vieles mehr: Eins steht fest – China polarisiert und stellt uns vor Rätsel. Trotz der scheinbaren Unvereinbarkeit von Autokratie und technologischer Innovation ist Chinas Staatskapitalismus bemerkenswert erfolgreich. Insbesondere in den Bereichen Technologie und Wirtschaft legt China ein Innovationstempo vor, das uns in Deutschland und Europa regelrecht aufrüttelt. Aus gutem Grund. Aktuell machen sich Chinas Ingenieure und Autobauer daran, die deutsche Automobilindustrie mit neuen E-Mobilitätskonzepten, revolutionären Batteriedesigns und preislich attraktiven, aber keineswegs billigen Automodellen herauszufordern.
Um das multipolare Thema China einigermaßen in den Griff zu bekommen, haben wir Frank Sieren als einen namhaften Kenner der Materie eingeladen, uns in einem Podiumsgespräch zu erläutern, was hinter Chinas Erfolg steht. Ist es die strategische Industriepolitik? Oder eher das einzigartige Mindset der chinesischen Unternehmer:innen, Forscher:innen und Gründer:innen, die eine andere Denkweise als wir in Deutschland haben oder gar beides? Schließlich, was können wir trotz aller systemischen Unterschiede von China lernen?
Durch den Formatwechsel vom Vortrag zum Interview mit Prof. Heinz-Otto Peitgen können wir auch Nebenaspekte beleuchten, die mit unserem diesjährigen Thema – Technologie, Resilienz und Innovation – in Verbindung stehen. Auf diese Weise können wir aktuelle Entwicklungen besser verstehen und einordnen. Denn das sind die Petersberger Gespräche in Reinkultur: Verstehen im und durch Dialog.
Video: Pragmatisches China? – Frank Sieren im Interview über den Vorsprung Chinas im Bereich Generativer KI
Im Anschluss an seinen Vortrag auf den Petersberger Gesprächen antwortet Frank Sieren auf die Fragen von Journalist Ralph Hötte. Es geht um Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz, bei denen China die Nase gegenüber dem Western vorne hat und um den Hintergrund, warum das so ist: Was schafft das Land und wie kann es gelingen, dass wir in Deutschland und Europa erfolgreicher werden und gleichzeitig unsere eigenen rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien aufrecht erhalten? Was können wir voneinander lernen und an welchen Stellen sollten wir anfangen andere Fragen zu stellen und einen Perspektivwechsel wagen?
Wir sind Gott – und dann?
„Allwissend“ und „allmächtig“ zu sein, sind Attribute, die der Mensch traditionell dem Göttlichen zuschreibt. Doch seit sich der naturwissenschaftlich-technologische Fortschritt beschleunigt hat wie nie zuvor, scheint sich der Mensch anzuschicken, mit Hilfe der sogenannten „KI“ selbst allwissend und allmächtig zu werden.
Thea Dorn betrachtet den menschlichen Drang nach Erkenntnis und danach, das Schicksal unter seine Kontrolle zu bringen, aus philosophisch-kulturanthropologischer Sicht. Sie diffamiert ihn weder als „Entzauberung der Welt“ noch als „Technologiegläubigkeit“, dennoch fragt sie, was es für unser Verständnis vom Menschsein bedeutet, wenn der naturwissenschaftlich-technologische Blick auf die Welt immer dominanter wird. Laufen wir Gefahr, die Rolle von Wissenschaft und Technik religiös zu überhöhen, wenn die Erwartungen, die wir an sie richten, immer mehr den Charakter von Heilserwartungen annehmen? Welche Konsequenzen hat es, wenn der Mensch keine anderen Formen der Kontingenzbewältigung mehr kennt als die, wirklich alles „in den Griff“ bekommen zu wollen? Was bedeutet es für unser Verständnis von menschlicher Autonomie, wenn wir erkennen müssen, dass die gesteigerte Kontrollmacht in Wahrheit nicht beim Menschen, sondern bei KI-basierten, immer „autonomeren“ Systemen liegt? Und was bedeutet all dies für die Zukunft unserer demokratisch verfassten Gesellschaften, die keineswegs auf Kontrolloptimierung zielen, sondern auf den Interessenausgleich zwischen für mündig gehaltenen Bürgern? Vor dem Hintergrund immer weiter anschwellender „Homo Deus“- und „Transhumanismus“-Phantasien entwickelt Thea Dorn ein leidenschaftliches Plädoyer für ein nach wie vor humanistisches Verständnis des Menschseins.
Video: Ein philosophischer Blick auf „Künstliche Intelligenz“ – Interview mit Thea Dorn
Im Anschluss an ihren Vortrag beantwortet Thea Dorn im Interview mit Journalist Ralph Hötte Fragen über den Intelligenzbegriff, das Bewusstsein und die Grenzen von Funktionalität im Kontext von KI.
Video: Thomas Armerding über die Petersberger Gespräche 2023
Thomas Armerding, Vorstandsvorsitzender der HANSA-FLEX AG, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Prof. Dr. Hans Maier über die Petersberger Gespräche 2023
Prof. Dr. Hans Maier, Co-Founder von und Managing Partner bei BGM Associates GmbH, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Burkhard Oppenberg über die Petersberger Gespräche 2023
Burkhard Oppenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Gothaer Systems GmbH, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Dr. Michael Müller-Wünsch über die Petersberger Gespräche 2023
Dr. Michael Müller-Wünsch, Bereichsvorstand Technology bei der Otto GmbH & Co. KG, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Philipp Deiters über die Petersberger Gespräche 2023
Philipp Deiters, Global Head of Division Food bei der Crespel & Deiters GmbH & Co. KG, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Dr. Jürgen Sturm über die Petersberger Gespräche 2023
Dr. Jürgen Sturm, CIO der ZF Friedrichshafen AG, berichtet über seine Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.
Video: Dr. Renate Jerecic über die Petersberger Gespräche 2023
Dr. Renate Jerecic, Head of Collaboration Office bei der Siemens Healthineers AG, berichtet über ihre Eindrücke der 15. Petersberger Gespräche in der Villa Hammerschmidt in Bonn.