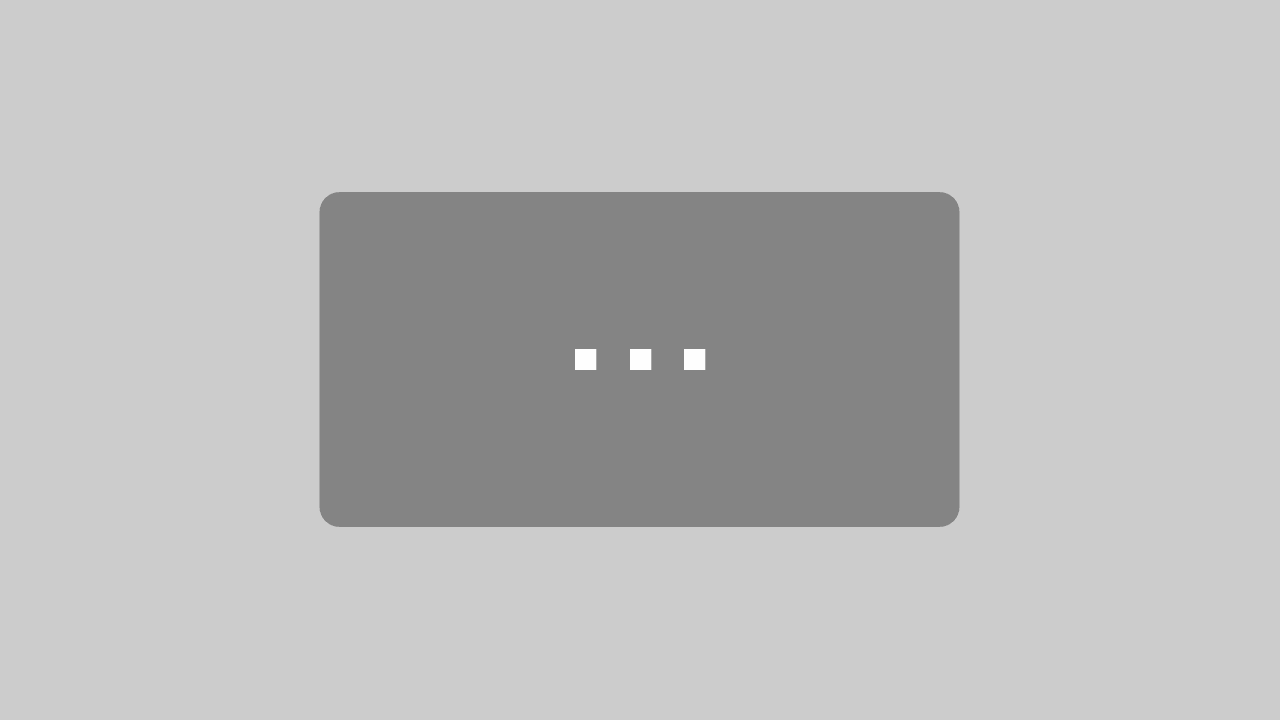Neu denken. Entscheiden. Anders machen.
Warum ein Wechsel der Perspektive für uns überlebenswichtig ist.
Veranstaltungsdatum: 17.09.2022
Stephan Huthmacher
Als vor vielen Jahren die Chaostheorie aufkam, wurde zur Veranschaulichung nicht-linearer Kettenreaktionen gerne das Beispiel des Schmetterlings in Afrika angeführt, dessen Flügelschlag zur Entstehung von Tornados im mittleren Westen der USA führen konnte. Die Parallelen zu den heute als komplex und chaotisch empfundenen Zuständen sind mehr als nur zufällig. Es war zum Beispiel nur ein einziges havariertes Containerschiff in einer der weltweit am meisten befahrenen Wasserstraßen, das für unvorhergesehene Kettenreaktionen, chaotische Zustände, Lieferengpässe sowie Produktionsstopps in vielen Industriezweigen und bei zahlreichen Unternehmen sorgte.
Sich häufende Extremwetter-Ereignisse in vielen Teilen der Erde verwandeln Märkte und ganze Wirtschaften in Asche und Schlamm – und Umsatzprognosen sowie Geschäftsstrategien in Makulatur. Nicht zuletzt ist der Krieg in der Ukraine in seinen nicht-linearen Konsequenzen kaum abzuschätzen. Nicht geopolitisch, nicht energiepolitisch oder ökonomisch und auch nicht in seinen Auswirkungen auf die globale Ernährungssituation.
Allein diese Beispiele zeigen: Ein „Weiter so“ ist keine Option mehr! Nicht von ungefähr bestimmt der Begriff „Zeitenwende“ seit Monaten die Diskussion; auch fand das diesjährige Weltwirtschaftsforum unter dem Motto „Geschichte am Wendepunkt“ statt.
In vielen Bereichen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft geht es um einen neuen Bedeutungsrahmen für das Vertraute. Um einen neuen Blickwinkel, unter dem wir unser bisheriges Tun betrachten. Dem Neu-Denken folgt das Anders-Entscheiden – und diesem ein anderes, der aktuellen Situation angepasstes Handeln.
Dies geschieht zum Beispiel, wenn Unternehmen ihre bisherige Praxis radikal unter der Perspektive der digitalen Transformation betrachten. Wenn sie in diesem komplexen und mit vielen Unsicherheiten behafteten Prozess ihre Geschäfte auf eine neue Stufe heben und zu datengetriebenen Unternehmen werden. Das kann auch bedeuten: Wertschöpfung mit und durch den Einsatz von smarten Technologien wie Big Data, Internet of Things, Künstlicher Intelligenz oder digitalen Ökosystemen erzielen.
Um eine Art zukunftsorientiertes Reframing handelt es sich auch, wenn in Forschungseinrichtungen völlig neue Wege begangen werden und Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen zum Beispiel in der Batterieforschung bisher nicht gestellte Fragen stellen – und so zu vorher undenkbaren, revolutionären Lösungen gelangen.
Mobilfunknetze sind etwas, von dem wir gewohnt sind, dass sie einen immer größeren Datendurchsatz ermöglichen und von Generation zu Generation immer schneller werden. Doch beim 6G-Netz wird das Mobilfunknetz selbst neu gedacht und in seinen Grundfunktionen erweitert. In einer Weise, die man in ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft wie auch auf unser Leben als revolutionär bezeichnen kann.
Bis vor einigen Jahrzehnten war die Raumfahrt nur staatlichen und wissenschaftlichen Institutionen vorbehalten. Seit knapp 20 Jahren entwickelt sie sich als private Raumfahrt zu einem Big Player der ganz eigenen Art. Zwei Fragen von vielen: Welche Lösungen für unsere irdischen Herausforderungen liegen oben im Weltall? Ist interplanetare Menschheit Spinnerei, ein Traum – oder doch denkbare Möglichkeit?
Auch in Forschung und Wissenschaft herrschen eingefahrene Denk-Loipen, deren spiegelbildliche Entsprechungen die Denk-Verbote sind. Vor allem die Pandemie hat uns gezeigt, wie unterschiedlich die gleichen Fakten von mehreren Wissenschaftler:innen beurteilt werden und wie aus ergebnisoffenem Diskurs ein medial ausgetragener Dissens werden kann. Was bleibt, ist eine verunsicherte Öffentlichkeit. Wie hier der richtige Umgang mit solchen Filterblasen und mit dem medialen Hang zur Negativität aussehen kann, zeigt nicht zuletzt die neurowissenschaftliche Forschung.
Kein Unternehmen kommt um die Frage herum, welche Voraussetzungen es intern schaffen muss, damit neue Blickwinkel und neue Perspektiven überhaupt gelingen können. Wie es eine innovationsfördernde Unternehmens- und Fehlerkultur entwickeln sowie Vertrauen aufbauen kann. Denn ganz gleich, ob als Denken, Entscheiden oder Tun – ausschlaggebend für das Neue ist, was in den Köpfen der Mitarbeiter und des Managements passiert.
Ein weiter Bogen an Themen, neuen Blickwinkeln und Perspektivwechseln. Die Petersberger Gespräche® werden auch in diesem Jahr alles dafür tun, um einen offenen Diskurs unter allen Teilnehmer:innen zu ermöglichen. Ein wichtiges Ziel unseres Kongresses wäre erreicht, wenn aus dem Dialog und den Diskussionen neue Sichtweisen entstehen, die zum Neu-Denken und zum Anders-Handeln in der unternehmerischen Praxis führen.
Impressionen der 14. Petersberger Gespräche 2022
Eröffnungsrede von Stephan Huthmacher
Einführung von Prof. Dr. Dr.-Ing. h. c. Heinz-Otto Peitgen
6G-Mobilfunk – Europas Chance? – Vortrag
5G, die fünfte Mobilfunk-Generation, wird aktuell landesweit ausgerollt. Hiermit wird nicht nur die Kapazität und Abdeckung verbessert. Der Innovationssprung mit 5G ist eine Funk-Plattform für die Realisierung von Funksteuerung kollaborativer Robotik und kabelloser virtueller und augmentierter Realität – das Taktile Internet. Z. Zt. entstehen spannende neue Möglichkeiten in der industriellen Produktion, im Verkehr, am Bau, in der Krankenversorgung und im Agrarbereich – alles neue Anwendungen im professionellen Umfeld. Mit 6G wird die breite Gesellschaft, der Endverbrauchende, von den Innovationen des Taktilen Internets profitieren. Neue Anwendungen der persönlichen mobilen Robotik und der virtuellen Realität werden unser Leben ähnlich revolutionieren, wie es die Einführung des Smartphones getan hat.
Welche Chancen und Herausforderungen stehen der Gesellschaft und der Wirtschaft Europas bevor? Was ist die europäische Stellung innerhalb des internationalen kompetitiven Umfelds? Können wir unseren demokratischen gesellschaftlichen Anspruch fortführen, um neue Chancen für Europa zu erkennen, und was müssen wir tun, um diese auch zu nutzen?
Interview mit Prof. Dr. Gerhard P. Fettweis
Die Entwicklung nachhaltiger Batterien: Neue Forschung. Neue Materialien. Neue Speicherkonzepte. – Vortrag
Die Entwicklung von Batterien, insbesondere für portable und für automobile Anwendungen, folgte jahrelang einer klaren Stoßrichtung: Die Batterien sollen mehr Energie auf kleinem Raum speichern können, sie sollen schnell aufladbar, sicher, langlebig und kostengünstig sein. Nachdem die Speicherkapazität der Lithium-Ionenbatterie (LIB) seit ihrer Kommerzialisierung 1991 um den Faktor vier gesteigert werden konnte und der Preis um den Faktor 18 sank, kommt es in neuerer Zeit zu einem Paradigmenwechsel bei den verwendeten Speichermaterialien. So werden die oben genannten Ziele gerade erweitert um die Forderung nach Systemen mit einer nachhaltigen Zusammensetzung. Dabei spielt eine Rolle, dass bis zum Jahre 2030 eine Verzehnfachung der Batterieproduktion erwartet bzw. angestrebt wird und dass bei einigen Rohstoffen wie Kobalt oder Lithium Engpässe befürchtet werden. Soll die Technik auf längere Sicht erfolgreich sein, muss die Aufgabe in Zukunft auf der Basis häufig vorkommender und ungiftiger Rohstoffe gemeistert werden, die gleichzeitig in der Lage sind, die oben genannten Ziele zu erreichen und so die Performance zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hat sich in neuerer Zeit ein äußerst fruchtbares Zusammenspiel von Chemie und Engineering ergeben, welches es mittlerweile erlaubt, leistungsfähige Speicher, z. B. für E-Autos, auch mit bereits bekannten nachhaltigen Materialien zu verbauen. Ein neues Innendesign der Batterie erlaubt es heute, die Materialpalette dafür deutlich zu erweitern. Doch die Zeit drängt. Für völlig neu zu entwickelnde Materialien werden deshalb in einigen Ländern erste KI-gesteuerte Anlagen zur beschleunigten Materialentwicklung aufgebaut – unter anderem in Ulm, wo gerade eine weltweit einzigartige, KI-gesteuerte autonome Robotik ihre Arbeit aufnimmt.
Interview mit Prof. Dr. Maximilian Fichtner
Q&A-Session mit Prof. Dr. Gerhard P. Fettweis & Prof. Dr. Maximilian Fichtner
Interview mit Prof. Dr. Maren Urner
Neue Wege in der Raumfahrt – neue Wege für die Menschheit? – Vortrag
Anfang 2002 wurde in Kalifornien eine Firma gegründet, die die “Entwicklung der Menschheit in eine interplanetare Spezies” zur Mission hatte. Dieses Ziel erschien für eine gerade gegründete Firma unerreichbar, zumal das erste Projekt – eine Rakete mit 21 m Länge, 1.8 m Durchmesser und dem Namen Falcon 1 – bescheidene Nutzlasten versprach. Diese Firma war SpaceX, kurz für Space Exploration Technologies.
Im Mai 2002 fing Hans Koenigsmann dort als vierter technischer Mitarbeiter an – zur rechten Zeit um, die frühe Entwicklung dieser mittlerweile bemerkenswert erfolgreichen Firma von Anfang an mitzuerleben und auch mitzubestimmen. SpaceX ging bewusst andere Wege, um anders zu werden – anders als die traditionellen Raumfahrtfirmen.
In den ersten Jahren lernte die Firma, was wirklich hinter der Raumfahrt steckt. Falcon 1 hatte hintereinander 3 Fehlschläge, bis 2008 endlich die Umlaufbahn erreicht wurde. Danach beschleunigten sich die Erfolge von SpaceX. Die wesentlich größeren Launcher Falcon 9 und Falcon Heavy folgten, dann die Wiedereintrittskapsel Dragon, die an die Internationale Raumstation andockt. Die Landung und die Wiederverwendbarkeit der ersten Stufe von Falcon 9 wurden entwickelt, und Falcon 9 und Crew Dragon führten Missionen mit Astronauten und sogar privaten Astronauten aus. Weitere Entwicklungen, die ebenfalls diskutiert werden sollten, sind Starlink (globales Internet) und Starship. Der Erfolg von SpaceX wird auf 2 Ebenen diskutiert – wie funktioniert diese Firma, die nach nur 20 Jahren den Markt dominiert? Und: wohin geht die (Raum-) Fahrt, warum macht die interplanetare Menschheit Sinn, und wann ist es so weit? Der Vortrag wird versuchen, die Zusammenhänge zwischen den Methoden, den Ergebnissen und den Möglichkeiten zu erklären.
Interview mit Dr. Hans Koenigsmann
Raumfahrt als Partner von Wissenschaft und Politik: Warum der Blick aus dem All für das Verständnis des Systems Erde unverzichtbar wird – Vortrag
Erdbeobachtungsmissionen in der Raumfahrt haben – egal, ob sie der militärischen Aufklärung, der Küstenüberwachung oder der Messung von Kohlendioxid in der Atmosphäre dienen – eines immer gemeinsam: sie ermöglichen einen unvoreingenommenen Blick von oben. Wenn die Menschheit mit Satelliten aus großer Höhe auf den Planeten schaut, verschafft sie sich eindeutige Fakten. Unsere Kultur basiert schlussendlich auf Erkenntnis, auf Empirie. Man gesteht sich ein, dass man nicht alles weiß, dass Beobachtung noch weitere Erkenntnis bringt und dass diese Erkenntnis dann möglicherweise das Verhalten verändert. Mit der neuesten Technologie satellitenbasierter Erdbeobachtung lassen sich diese Veränderungen heute präzise messen und verfolgen. Das ermöglicht es Wissenschaftler:innen, die Folgen unserer Handlungen auf der Erde besser einschätzen zu können und damit der Politik Empfehlungen zu liefern, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dieses faktenbasierte Verständnis des Systems Erde kann die Entscheidung über Wohl und Wehe unserer Zivilisation maßgeblich beeinflussen.
Interview mit Marco Fuchs
Q&A-Session mit Dr. Hans Koenigsmann & Marco Fuchs
Agile Unternehmenskultur als Brückenschlag zu neuen Denkrahmen und innovativen Handlungsoptionen – Vortrag
Mehr denn je sind Unternehmen mit immer komplexeren und brüchiger werdenden Kontexten konfrontiert. Gleichzeitig sehen viele Unternehmen auch die enormen Chancen, die durch die digitale Transformation entstehen. Angesichts dessen stellen sich viele Führungskräfte die Frage: Wie schaffen wir den Brückenschlag von einer mechanistischen Organisationsstruktur hin zu einer Unternehmenskultur, die anpassungsfähige Strukturen und Praktiken hervorbringt?
Angelika Bachmann greift mit der Unternehmenskultur einen Managementaspekt heraus, der erfolgreich als Koordinationsmechanismus eingesetzt werden kann, um neue Denkrahmen, Perspektivenwechsel und mutige Entscheidungen zu ermöglichen. Eine Herausforderung ist dabei das Management der Komplexität, die aus den formellen und informellen Interaktionen aller Unternehmensakteurinnen und -akteure entsteht. Kann und sollte man dabei die individuellen Mindsets der Mitarbeitenden und Führungskräfte (wie) verändern? Anhand anschaulicher Beispiele aus ihrer Coachingpraxis gibt sie Impulse, wie Unternehmen ihre Organisation durch die Einführung einer agilen Unternehmenskultur weiterentwickeln, für sich neue Ressourcen erschließen und ihre Selbstorganisationsfähigkeit und Resilienz steigern können. Nicht zuletzt, wie sich eine Fehler-, Vertrauens- und Innovationskultur nachhaltig gestalten und leben lässt.
Interview mit Angelika Bachmann
Q&A-Session mit Angelika Bachmann
Dr. Michael Tagscherer über die Petersberger Gespräche 2022
Dr. Michael Tagscherer, CTO, Giesecke + Devrient GmbH
Ulrich Keller über die Petersberger Gespräche 2022
Ulrich Keller, Financial Controller, Interim Manager, Commerzbank AG
Detlef Frank über die Petersberger Gespräche 2022
Detlef Frank, Mitglied des Vorstands, HUK24 AG
Dr. Siegbert Martin über die Petersberger Gespräche 2022
Dr. Siegbert Martin, CTO, Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Uli Brödl über die Petersberger Gespräche 2022
Prof. Dr. Uli Brödl, Head of Global Clinical Development & Operations, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Florian Gantner über die Petersberger Gespräche 2022
Prof. Dr. Florian Gantner, Global Department Translational Medicine & Clinical Pharmacology, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Dr. Margareta Büning-Fesel über die Petersberger Gespräche 2022
Dr. Margareta Büning-Fesel, Leitung Bundeszentrum für Ernährung in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Walter Märzendorfer über die Petersberger Gespräche 2022
Walter Märzendorfer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Medical Valley EMN e.V.
Nico Michels über die Petersberger Gespräche 2022
Nico Michels, Senior Vice President Engineering System, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Hans-Ulrich Wolf über die Petersberger Gespräche 2022
Hans-Ulrich Wolf, Executive Vice President, Global Head of IT and Data, EVOTEC SE
Dr. Matthias Trabandt über die Petersberger Gespräche 2022
Dr. Matthias Trabandt, Head of Group IT, Swiss Life AG